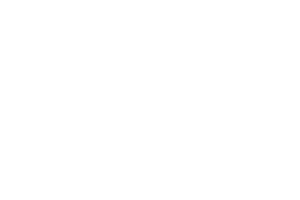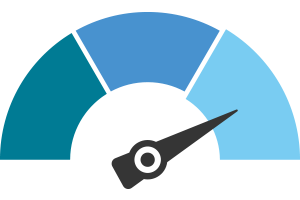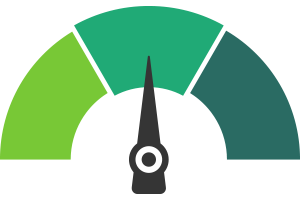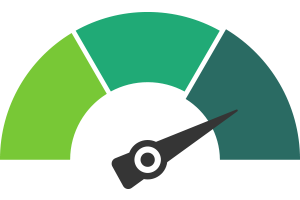Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) hat eine Leitlinie zum Schutz der Patientinnen und Patienten vor Über- und Unterversorgung veröffentlicht. Darin wird eine ausgewogene, patientenzentrierte und evidenzbasierte Versorgung als geeignetes Mittel hervorgehoben, um sowohl Über- als auch Unterversorgung zu verhindern.
Zur Verminderung von Überversorgung empfiehlt die Leitlinie, unnötige Maßnahmen durch sorgfältige Abwägung der Nutzen-Risiko-Relation zu vermeiden. Weitere Punkte sind regelmäßige Fortbildungen und die Anwendung weiterer Leitlinien sowie die enge Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, um deren Erwartungen realistisch zu steuern.
Andererseits sollte aber auch Unterversorgung vermieden werden, z. B. die unzureichende Behandlung chronischer Erkrankungen, die Vernachlässigung präventiver Maßnahmen oder das Fehlen von Nachsorgeuntersuchungen nach schweren Erkrankungen. Die DEGAM-Leitlinie betont hier die Notwendigkeit einer kontinuierlichen, umfassenden Versorgung, insbesondere bei chronisch kranken und multimorbiden Patientinnen und Patienten. Auch hier spielt die evidenzbasierte Medizin eine zentrale Rolle, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden.
Hausärzte und Hausärztinnen spielen in beiden Fällen eine zentrale Rolle: Sie haben als „Gatekeeper“ den Überblick über die gesamte Versorgung der Patientinnen und Patienten und können unnötige Maßnahmen verhindern (Koordination). Darüber hinaus begleiten sie die Patientinnen und Patienten über einen längeren Zeitraum (Kontinuität der Versorgung) und können so potenzielle Über- und Unterversorgung besser im Blick haben.
Die Leitlinie fordert außerdem, dass Patientinnen und Patienten umfassend über mögliche Risiken und den zu erwartenden Nutzen von Maßnahmen informiert werden, um eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die realistische Vermittlung dessen, was durch medizinische Maßnahmen erreicht werden kann, um dadurch potenziell unnötige Behandlungen zu vermeiden.
Ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von „low value care“ (10) Darunter versteht man medizinische Maßnahmen, die keinen oder lediglich einen geringen Nutzen haben und möglicherweise sogar Schaden verursachen können. Diese Maßnahmen bieten im Verhältnis zu den entstehenden Kosten, Risiken und Nebenwirkungen keinen ausreichenden Mehrwert. Diese Maßnahmen bieten im Verhältnis zu den entstehenden Kosten, Risiken und Nebenwirkungen keinen ausreichenden Mehrwert. Dazu gehören unnötige Diagnostik (z. B. Bildgebungen beim akuten nicht-spezifischen Rückenschmerzen), überflüssige Therapien (z. B. Antibiotika-Gabe bei viralen Infektionen) oder Überdiagnose (z. B. langsam wachsendes Prostatakarzinom).
Tatsächliches CO2 Einsparpotenzial:
100 kg CO2e/Jahr/Kopf bei Überversorgung (11)